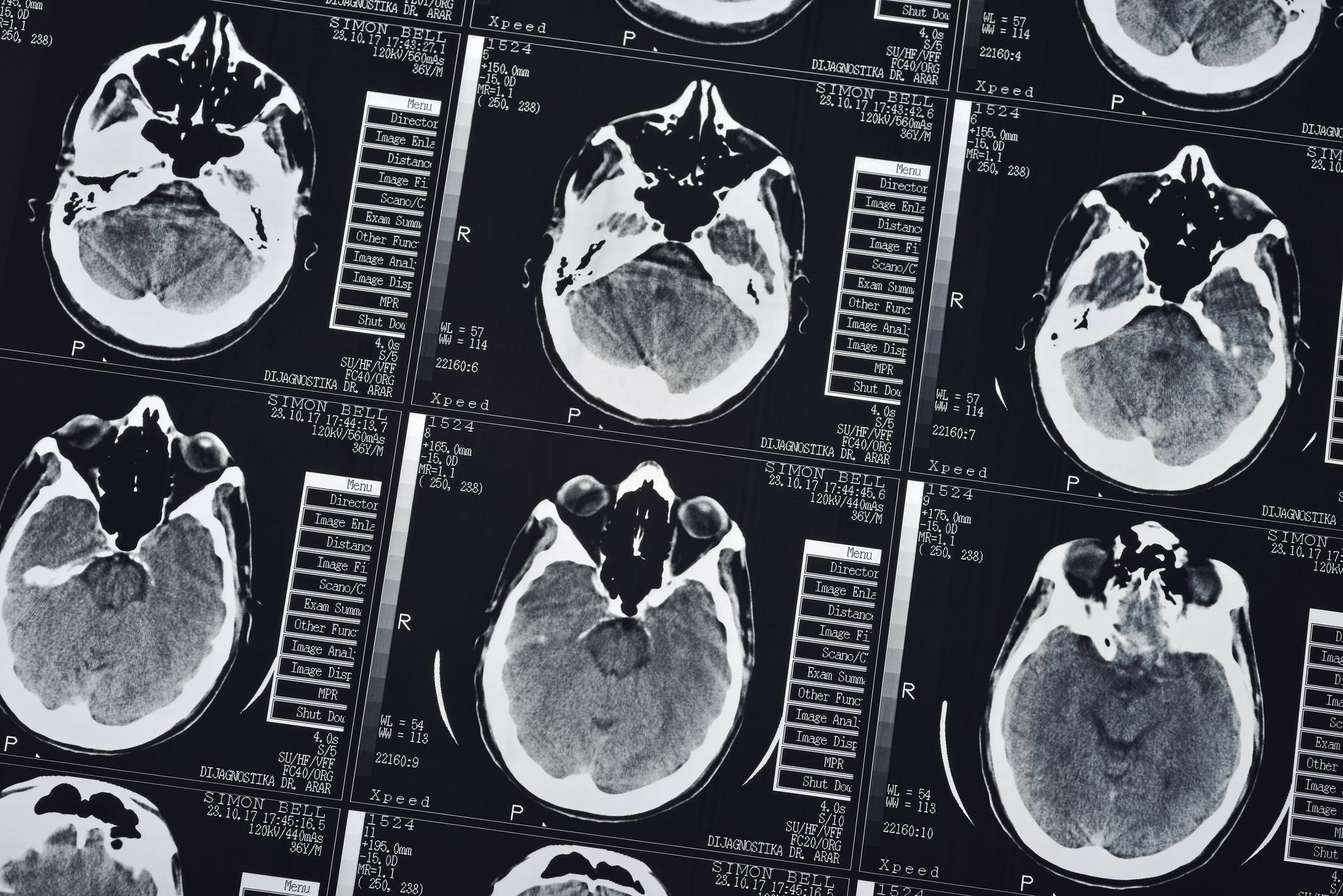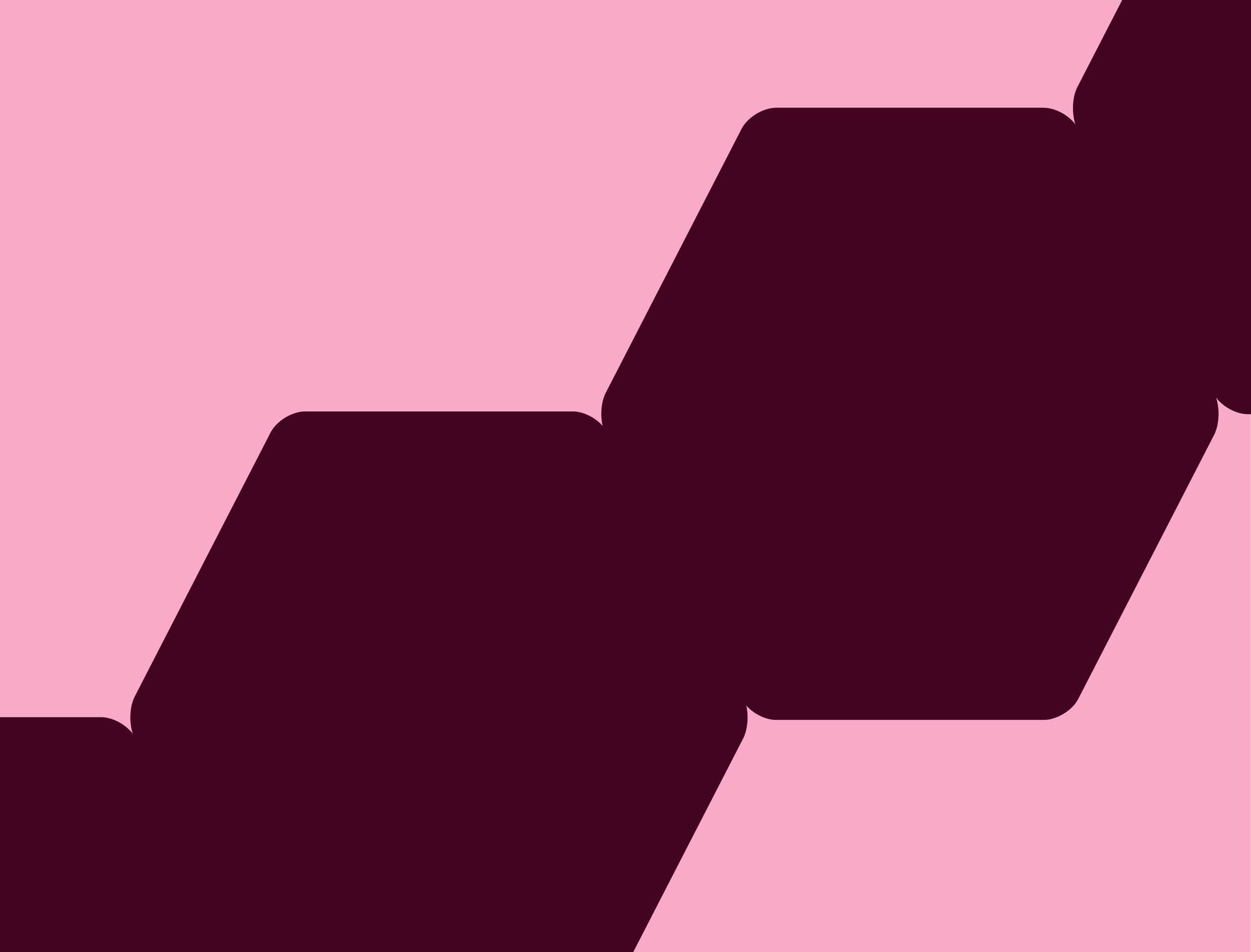
Wie Gender in die Sprache kam - und was wir damit machen
Seit Oktober 2022 untersucht der Kanal „Gendergerechte Sprache“ sprachwissenschaftliche wie gesellschaftliche Positionen, Theorien und Erkenntnisse rund um den Diskurs zum Gendern. In 61 Texten gingen unsere Kurator*innen, Redakteur*innen und Gastautor*innen zu zahlreichen Aspekten des Themas ins Detail: von den grammatischen Grundlagen vergeschlechtlichter Sprache über die Pseudo-Generizität von Maskulina bis hin zu Strategien des Sprachwandels in der Praxis. Der folgende Diskurs-Hub führt die Texte zusammen und macht sie anhand von drei Knotenpunkten navigierbar: Wie entstand und entwickelte sich das Genus? Welchen Einfluss haben Genus und Gender auf unser Sprechen, Hören und Denken? Und mit welchen gesellschaftlichen Umbrüchen und Anforderungen hängt der Wandel hin zu gendergerechter(er) Sprache zusammen?
Gegenwärtige Grabenkämpfe um den Umgang mit gendergerechter Sprache bilden die Spitze eines Eisbergs, der sich seit Jahrzehnten durch Gesellschaften weltweit schiebt. Die Linguistik setzt sich mindestens ebenso lange damit auseinander, wie Genus-Kategorien entstanden sind, in welcher Verbindung sie mit dem Sexus stehen und wie sie kulturelle Vorstellungen von Geschlechterrollen prägen. Begleitet werden diese Arbeiten von feministisch-aktivistischen Ansätzen, von sozialwissenschaftlicher Forschung und von Projekten, die sich zwischen diesen Welten bewegen und im Folgenden versammelt sind.
Disclaimer: Wir nutzen in diesem Text das Gendersternchen mit dem Ziel, alle Geschlechter anzusprechen und einzubeziehen. Ausnahmen finden dort statt, wo Menschen nach unserem Wissen eine andere Art des Entgenderns bevorzugen oder sich gegen das Gendern ausgesprochen haben.
Genus
Sprache ist ein zentraler Bestandteil dessen, was uns als Menschen ausmacht. Mittels Sprache nehmen wir Bezug auf die Welt, aufeinander und uns selbst. Mittels Sprache treten wir in Austausch, verleihen den Dingen Sinn und Bedeutung. Gleichzeitig wirkt Sprache auf uns zurück. Sie kann die Art und Weise prägen, wie wir denken und urteilen. Die Lexik gibt die Wörter vor, derer wir uns im Sprachgebrauch bedienen und die Grammatik — Bauplan für die Art und Weise Sätze zu bilden — gibt die Regeln vor, nach denen wir diese Wörter verbinden. Die Formen sprachlichen Ausdrucks, die wir heute vorfinden, sind in Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Gehirnstruktur einerseits, sozialen und geschichtlichen Prozessen andererseits über eine Zeitspanne von mehreren 10.000 Jahren entstanden. Was uns heute oft als selbstverständlich oder vielleicht sogar unhintergehbar, als der Grund der Dinge selbst erscheint, hat eine Geschichte. So auch das Genus, eine grammatische Kategorie, die allen Nomen der deutschen Sprache inne ist und die weiter Teile des grammatischen Systems prägt. Es sortiert die Welt sprachlich in drei Kategorien: Femininum, Maskulinum und Neutrum.
Tot oder Lebendig
Die Geschichte des Genus beginnt möglicherweise in der Jungsteinzeit – und zwar mit einer Unterscheidung, die mit Geschlecht vermutlich gar nichts zu tun hat. Zunächst unterschied die Grammatik in unseren (und noch heute in vielen anderen) Gefilden aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen tot und lebendig, oder linguistischer ausgedrückt - belebt vs. unbelebt. 00 Parallel entwickelten sich neue Formen, die vermutlich zunächst dem Ausdruck von weniger Greifbarem dienten: Sie unterschieden zwischen der Gruppe und dem Einzelnen sowie zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten.
Dreigeteilt
Kollektives und Abstraktes verschmolzen und wurde zu einer dritten Kategorie. So entstand ein dreigeteiltes System, die Welt in Worte zu fassen: belebt, unbelebt und kollektiv/abstrakt. Wäre es dabei geblieben, hätte es unseren Kanal vermutlich nie gegeben. Ab einem gewissen Zeitpunkt aber, etwa zu Beginn der Eisenzeit, hatten sich Maskulinum, Femininum und Neutrum als Genusformen herauskristallisiert. Der genaue Verlauf dieses Prozesses ist jedoch bis heute nicht geklärt. Viele Forschende nehmen an, dass aus dem Unbelebten das Neutrum wurde, während aus der belebten Kategorie das Maskulinum hervorging und das Kollektiv-Abstrakte zum Femininum umgedeutet wurde.
Grammatisches Genus
Es heißt „der Tisch“ und „die Gabel“. So wie es „der Mann“ und „die Frau“ heißt. Doch inwiefern kann man deswegen einen Sinnzusammenhang zwischen Genus (grammatischem Geschlecht) und Sexus (biologischem Geschlecht) postulieren? Viele Jahrhunderte lang gingen die Menschen von einer festen Entsprechung zwischen Grammatik und Geschlecht 00 aus. Dabei zeigt die Sprachgeschichte: das grammatische Genus hat sich von tot, lebendig und kollektiv/abstrakt zu maskulin, feminin, neutrum entwickelt – es ist, so wie die meisten sprachlichen Kategorien, ein sprachgeschichtlicher Zufall und keine Naturgegebenheit. Dies verdeutlicht allein der Fakt, dass es viele Sprachen gibt, die keine geschlechtliche Unterscheidung 00 kennen.
Semantisches Sexus
Der Sexus ist ebenfalls nicht in Stein gemeißelt. In seiner traditionellen Interpretation bezieht er sich auf das vermeintlich natürliche Geschlecht. Dabei handelt es sich jedoch, wie zahlreiche Untersuchungen im Grenzbereich zwischen Sozial- und Naturwissenschaften zeigen, um eine unscharfe Kategorie. 00 Endungen und Pronomen, mit denen seit nunmehr 3000 Jahren Geschlecht ausgedrückt wird, verweisen nicht auf Genitalien oder gar auf Chromosomen, von denen wir erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts wissen. Sie verweisen auf die wahrgenommene Rolle 00 einer Person. Die semantische Kategorie Sexus hat damit auch soziale Aspekte, ihre Zwiekonzeption als männlich oder weiblich wird von kulturellen Überzeugungen 00, Normen und Werten mitgeformt, die historisch bedingt und tradiert sind. Verschiedene Gesellschaften haben oder hatten unterschiedliche Ansichten und Konzepte von Geschlecht 00 entwickelt, die sich von der binären Vorstellung unterscheiden.
Generisches Maskulinum
Im deutschsprachigen Raum erleben wir seit mehreren Jahrzehnten eine Debatte darüber, wie mit der Genderspezifizierung bei Personenbezeichnungen – Wörtern wie „Lehrer“ oder „Koch“ – umgegangen werden soll. Im Englischen wurde 1850 das Maskulinum kurzerhand per Gesetz zur neutralen Form erhoben – von Ursula Doleschal als „patriarchales normatives Ergreifen“ 00 bezeichnet. Im Deutschen spielten sich die sozialen Dynamiken etwas subtiler ab, doch das Ergebnis war auch hier das gleiche. Frühe Belege für eine generische Verwendung maskuliner Formen finden sich schon in Schriften aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen. 00 Während frühere Grammatiken noch geschlechtsneutrale Strukturen wie das Genus commune oder das Neutrum für gemischtgeschlechtliche Kontexte erwähnten, setzte sich spätestens im 20. Jahrhundert der generisch-maskuline Sprachgebrauch stärker durch. Formulierungsvarianten mit Neutrum wie „Vater und Mutter sind jedes ein Mensch für sich“, die früher mit geschlechtsabstrahierenden Maskulina koexistierten und die es heute noch in Sprachen wie dem eng mit dem Deutschen verwandten Isländischen gibt, fielen zwischen dem 16. und 21. Jahrhundert gänzlich aus dem Gebrauch. Der Einfluss der Grammatikschreiber (und dieses Maskulinum ist hier nicht generisch), die Prestige und Hochsprache nicht nur abbildeten, sondern auch aktiv prägten, wird deutlich.
Heute ist an die Stelle einzelner Universalgelehrter die Linguistik als wissenschaftliche Disziplin getreten. Deren Ergebnisse werden in der öffentlichen Debatte von Verfechter*innen unterschiedlicher Positionen oft instrumentalisiert 00: Wer gegen das generische Maskulinum argumentiert, sieht sich durch psycholinguistische Studienergebnisse bestätigt, wer dafür ist, beruft sich darauf, grammatisch gut informiert zu agieren, denn gegenderte Formen scheinen nicht konform mit den etablierten Regeln der Sprache.
Gehirn
Ein wichtiger Beitrag der linguistischen Forschung ist der Versuch, Sprache über die Perspektive einzelner Sprecher*innen hinaus zu erfassen und durchdringen. Die Psycholinguistik liefert dafür experimentelle Methoden, um der instinktiven Sprachbewertung der Menschen ein wenig auszuweichen und an die unterbewusste Ebene sprachlicher Prozesse heranzukommen. In Bezug auf gendergerechte Sprache ergeben sich dabei Fragen wie: Wie beeinflussen Genus und Gender unser Sprechen, Hören und unser Denken?
Einer für alle?
Bereits in den 80er Jahren hatte Foxx Silveira postuliert 00, dass die Verwendung von generisch maskulinen Formen im Englischen ein Symptom einer impliziten kulturellen Gleichsetzung von „Mensch“ mit „Mann“ war. Mit ihren sprachphilosophischen Arbeiten legte sie eine der Grundlagen, an denen sich das Feld der Psycholinguistik bis heute orientiert. So haben etwa Pascal Gygax und sein Team für das Deutsche, Englische und Französische experimentell überprüft, wie sich generische Maskulina auf das Mitdenken anderer Geschlechter auswirken. Sie fanden heraus: In Sprachen wie Deutsch und Französisch, deren Nomen eine grammatische Genderinformation in sich tragen, berufen wir uns beim Verstehen so stark darauf 00, dass selbst frauendominierte Berufsfelder männlich gelesen werden. Dies geschieht selbst, wenn wir mit Pronomen arbeiten 00, die im Deutschen in ihrer Plural-Form vermeintlich feminin klingen 00 („sie“, „Männer, die …“) – auch wenn dieses Lautbild den Effekt etwas schwächt. In Sprachsystemen wie dem des Englischen, das diese Kategorie nicht mitbringt, ist es das Weltwissen, das das Verstehen lenkt.
Hören, Lesen, Verstehen
Niels O. Schillers Forschung untermauert die besondere Rolle der lautlichen Wiedergabe des grammatischen Genus 00: In Sprachen, in denen beispielsweise die Artikel mit dem Nachfolgewort verschmelzen können (z.B. im Französischen: le + oiseau = l'oiseau „der Vogel“), sind die Irritationen darüber, dass das Genus zweier Wörter nicht zusammenpasst. mitunter geringer. Dies zeigt uns, dass Genus nur eine von vielen gleichwertigen Kategorien ist, die unser Sprachverstehen leiten. Ein elektroenzephalographischer Blick ins Gehirn 00, wie ihn Julia Misersky und ihre Kolleginnen wagten, deckt die Spuren auf, die das generische Maskulinum im Gehirn hinterlässt. Ein Wort im Maskulinum wie „die Studenten“ ist beim Satzverstehen scheinbar schwierig mit einem femininen Wort wie „die Frauen“ zusammenzubringen, weil unser Gehirn ein weiteres Wort im Maskulinum erwartet.
Nicht ganz so generisch
Die Psycholinguistik liefert recht klare Hinweise darauf, dass das generische Maskulinum nicht alle Menschen gleich gut repräsentieren kann. Jedoch werden ihre Ergebnisse bisweilen aufgrund der kleinen Stichproben und scheinbar unnatürlichen Versuchsaufbauten kritisiert. Dem setzten Dominic Schmitz und seine Kolleginnen im letzten Jahr eine neue Methode 00 entgegen: Sie entwickelten ein KI-Modell, das eine riesige Menge an Nachrichtentexten darauf untersuchte, mit welchen anderen Begriffen Maskulina und Feminina jeweils verknüpft sind... Dabei konnten sie statistisch zeigen, dass generische Maskulina im Deutschen nicht wirklich generisch sind: Wer Lehrer sagt, weckt vorwiegend Bilder von Männern. Weibliche Berufsbezeichnungen 00 sind dagegen ein ganz eigenes Bedeutungsfeld mit Assoziationen, die sich nicht mit den pseudo-generischen Maskulina decken. So ist es auch wenig überraschend, dass Kinder beim Lesen von generisch maskulinen Berufsbezeichnungen weniger an Frauen und andere Geschlechter denken. Die Prägung des Selbstbildes und potenzieller Berufsvorstellungen von Kindern ist eine klare Schnittstelle zwischen Grammatik und Gesellschaft.
Geschlecht geredet
1973 beobachtete Robin Lakoff 00 sowohl den eigenen Sprachgebrauch als auch den von Freund*innen und Bekannten. Dabei stellte sie fest, dass weiblich markierte Sprache sich durch Zurückhaltung und Rückversicherung auszeichnet, was wiederum als zaghaft und machtlos interpretiert würde. Lakoff schließt daraus, dass Frauen sich über ihren Sprachgebrauch von der Wahl und der Ausübung von Macht- und Autoritätspositionen disqualifizieren würden. Ihre Hypothesen wurden 20 Jahre später 00 als zu plakativ eingestuft, denn wie wir sprechen, ist von vielen weiteren sozialen Faktoren (Alter, Klasse, Beruf, etc.) geprägt. Dennoch konnte Lakoff zeigen: Gender spielt im Sprachgebrauch eine Rolle. Nicht nur, welche Wörter wir verwenden, sondern auch, wie wir sie sagen 00, wird durch Gender beeinflusst. Sprechmerkmale wie Stimmhöhe, Deutlichkeit des Sprechens und Sprechtempo werden von Hörer*innen als Hinweise auf das Gender des Gegenübers interpretiert. Diese Unterschiede sind jedoch nicht nur auf binäre Weise verteilt, sondern zeigen Überschneidungen.
Gesellschaft
Die Gesamtheit der heutigen Forschungsergebnisse über die Entstehungsgeschichte des grammatischen Genus und die Auswirkungen der Sprache auf unser Denken war vor 50 Jahren noch nicht präsent. Was es aber gab, war ein Gefühl von Frustration und Ärger ob der gesellschaftlichen Ungleichbehandlung von Frauen und Männern. Erst seit 1958 dürfen Frauen in der BRD ohne die Erlaubnis des Ehemanns ein eigenes Bankkonto eröffnen und einen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Bis 1977 durften sie das zudem nur, wenn die Lohnarbeit mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Gleiche Rechte für Mann und Frau gelten laut Grundgesetz seit 1958, müssen jedoch in der Praxis hart erkämpft werden. Gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich nicht von einem Tag auf den anderen – genauso wenig wie die Sprache.
Feministische Linguistik
Der Anfang der feministischen Linguistik liegt in den 1970er Jahren, als Frauen begannen, sich dafür einzusetzen, in der Sprache sichtbarer zu werden. Vor allem die Verwendung des generischen Maskulinums wurde in Artikeln von Luise Pusch und Senta Trömel-Plötz kritisiert. „Deutsch ist eine Männersprache” sagten sie. Bald wurden Alternativen vorgeschlagen, die Frauen nicht nur „mitmeinen“, sondern auch mitbenennen. Die Doppelnennung, (z. B. „Schülerinnen und Schüler“) ist eine der ältesten Formen, die zwei Geschlechter sprachlich sichtbar macht. Als Abkürzung etablierte sich zunächst das Binnen-I („SchülerInnen“). In manchen feministischen Kreisen wird auch ein sogenanntes generisches Femininum 00 verwendet.
Überlegungen zu Neuerungen in der Sprache im Sinne der Gleichberechtigung bilden seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten einen Dreh- und Angelpunkt zeitgenössischer Kulturkämpfe. Hinter der Auseinandersetzung steht auch die Frage um die Wirkmacht von Sprache insgesamt. Schafft Sprache Wirklichkeit 00 – wie Vertreter*innen gendersensibler Sprache immer wieder anführen – oder bildet sie bestehende Realitäten lediglich ab? In jedem Fall hat sich der gesellschaftliche Sprachgebrauch seit den 1970er Jahren verändert. Viele Studentenwerke heißen heute Studierendenwerke, Frauen sind nicht mehr gezwungen, bei einer Eheschließung ihren Nachnamen zu wechseln und das Wort „Fräulein“ wird für Erwachsene höchstens noch ironisch gebraucht.
Sex und Gender
Die heute gängige Unterscheidung von Sex und Gender als „soziales“ beziehungsweise „biologisches“ Geschlecht findet zunehmend Eingang in den öffentlichen Diskurs. Gendersoziolog*innen weisen jedoch darauf hin, dass die Unterscheidung keineswegs so trennscharf ist, wie so oft scheint. Die zeitgenössische Biologie ist sich über die Frage, wie sich Geschlecht bestimmen lässt, keineswegs einig. 00 Sozialwissenschaftliche Studien weisen zudem darauf hin, dass auch der Blick der Naturwissenschaften sozial geprägt ist. 00 Für feministische Forscher*innen wie die Philosophin Sally Haslanger ist „Gender“ vor allem eine politische Kategorie. Sie definiert Gender als soziale Position, als Ausdruck eines Zwei-Klassen-Systems, in dem Männern die dominante und Frauen die untergeordnete Stellung zukommt – und lanciert ein neues Genderverständnis als Instrument für ein emanzipatives Projekt. 00
Queerfeminismus und Genderstern
Insgesamt wird der Genderdiskurs ab den 1990er Jahren deutlich diverser. Intersektionale Feministinnen wiesen darauf hin, dass Arbeiterinnen, Migrantinnen und queere Menschen in gesellschaftlichen Diskursen oft nicht mitbedacht werden. Auch öffnet sich der Diskurs stärker für nicht-binäre 00 und intergeschlechtliche Menschen.
Aus der Schreibweise trans* (für transgeschlechtliche Menschen), die sich seit den 1990ern etablierte, entwickelte sich das heute vielerorts gängige Gendersternchen. Sozialphilosoph_in Steffen Kitty Herrmann rief um 2003 den Unterstrich ins Leben, der ebenfalls Identitäten jenseits von Mann und Frau sichtbar machen sollte. Im Laufe der 2010er Jahre wurden diese Formen auch in der gesprochenen Sprache populärer und als Glottisschlag bzw. kleine Pause 00 realisiert.
Kritische Stimmen
Während viele Menschen die neuen gendersensiblen Formulierungen begrüßen und in Wort und Schrift verwenden, gibt es auch kritische Stimmen 00 – sowohl aus gesellschaftspolitischer Perspektive als auch aus der Linguistik. 00 Angeführt wird etwa, die sogenannte „Gendersprache“ sei zu kompliziert, zu lang und zu unleserlich, sie sexualisiere die Sprache und entspreche nicht der Duden-Schreibweise. Für andere, etwa den Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant, ist geschlechtergerechte Sprache mit einer Politisierung der Sprache 00 verbunden, die die Bezüge zwischen Sprache, Denken und Welt auf eine einzige Dimension von „Richtigkeit“ reduziere.
Für diese Kritiker*innen sind die Identitäten aller Menschen mit der Doppelbelegung des Maskulinums abgedeckt und die Schaffung neuer Formen und deren Institutionalisierung demnach hinfällig. Im Juli 2022 forderten zahlreiche Sprachwissenschaftler und Linguisten die öffentlich-rechtlichen Medien dazu auf, auf gendergerechte Sprache zu verzichten. 00 Auch manche Feministinnen der Zweiten Welle, die sich in den 1980er Jahren für gendergerechte Formulierungen eingesetzt hatten, befürworten nicht unbedingt den Genderstern, jedoch aus anderen Gründen: So wirft die feministische Linguististin Luise Pusch der Queer-Community vor, der Genderstern 00 suggeriere Gleichberechtigung, privilegiere aber gleichzeitig Männer, indem ihnen der Wortstamm bleibe – während Frauen am Ende doch die „blöde Endung -innen“ zugewiesen werde.
Barrierefreiheit
Oft wird gegen das Gendern angeführt, es lasse die Belange von beispielsweise Sehbehinderten, Menschen mit Lernbehinderungen oder eingeschränkten Sprachkenntnissen außer Acht. Kristina Bedijs argumentiert jedoch, dass Texte in Einfacher Sprache kein Ersatz 00 für standardsprachliche Texte sind, sondern eine Ergänzung. Einfache Sprache ist dann also mehr eine ergänzende Hilfestellung für eine Sprachwelt, in der so oder so zunehmend die Sterne in der textlichen Umwelt aufgehen. Die Inklusionsbedürfnisse unterschiedlicher Gruppen müssten sich nicht widersprechen. Eine Möglichkeit, die Bedijs dafür vorschlägt, ist ein Gender-Disclaimer vor dem Text, der neue Formen erklärt und begründet. Und so können alle mitreden, sogar die Mitglieder der Gesellschaft, die all diese Bedürfnisse in sich vereinen.
Flexibel bleiben
Entgegen manchen Behauptungen wird niemand zur Nutzung des Gendersternchens gezwungen. Zudem hat jede*r die Auswahl zwischen vielen Formen – es gibt keinen Mangel an Ratgebern 00, die Vor- und Nachteile 00 der jeweiligen Form erklären. Neben den bereits erwähnten Methoden der Doppelnennung, des Unterstrichs, des Partizips und des Gendersternchens wird an manchen Stellen auf menschliche Nomen verzichtet, um dem Problem aus dem Weg zu gehen: „Wer hat das geschrieben?“ statt „Wer ist der Autor“?
Doch auch für auf Menschen referierende Nomen gibt es eine Vielzahl kreativer Ideen, sie geschlechterübergreifender klingen zu lassen: Das Germanisty Thomas Kronschläger schlägt vor, nach der Methode des österreichischen Künstlys Hermes Phettberg mit -y zu entgendern 00. Martin Krohs präsentiert ausgehend von geschlechtsübergreifend verwendeten Nomen wie „die Hilfe“ und „die Wache“ als Lösung eine -e Endung und darf fortan als „eine Philosophe“ 00 bezeichnet werden. In queerfeministischen Kreisen entstehen Wort-Neuschöpfungen wie „Studens“, „Professix“ oder „Schreiblon“ 00 so wie Neo-Pronomen 00 wie beispielsweise „sier“ oder „nin“. Worte, die über „er“, „sie“ und „es“ hinausgehen und von Menschen genutzt werden, die sich im bestehenden Angebot an Pronomen nicht repräsentiert fühlen.
Für die Anwendung in Schulen 00, Verlagen und Institutionen fand Helmuth Feilke vor dem Hintergrund, dass Gendern auch als Respektsignal zu verstehen ist, einige Kompromisse 00: Wenn auf Individuen oder Gruppen referiert wird, soll und darf gerne gegendert werden. Wenn es jedoch um Rollenreferenzen und Pronomen wie in „Jeder ist seines Glückes Schmied” geht, sei eine generisch maskuline Form angebracht. Flexibilität ist eine Lösung: Der Philosoph Martin Seel etwa wirbt für einen „sprachpolitischen Okkasionalismus“ 00 - eine Haltung, die versucht, mit unterschiedlichen Spielarten der differenzsensiblen Kommunikation den Anforderungen der jeweiligen Situation gerecht zu werden. Es bleibt ein Prozess des Aushandelns. Wie wollen wir unsere gemeinsame Sprache verwenden? Wie können wir uns mit Bezug auf Geschlecht präzise ausdrücken, wo nehmen wir Ungenauigkeiten zugunsten von Knappheit und Kürze in Kauf?
Andere Sprachen
Ein Blick auf andere Sprachen zeigt: Die Sprecher*innen des Deutschen sind nicht die einzigen, die sich um inklusive Sprache Gedanken machen. Im Englischen unterscheiden die meisten Substantive kein Genus (es gibt jedoch Ausnahmen wie z.B. actress, „Schauspielerin“). Dafür gibt es Pronomen, die grammatisches Geschlecht unterteilen: he, she, it („er, sie, es“). Alle Geschlechter scheinen in der Grundform des Nomens inkludiert. Keine Endungen und kein Gendersternchen notwendig, alle zufrieden? Nicht ganz. Ein wenig Aufwand 00 war schon notwendig, um aus den firemen („Feuerwehrmänner“) firefighter („Feuerwehrleute“) zu machen. Studien zeigen zudem, dass Geschlechterstereotype trotzdem vorhanden sind. 00 Das Wort engineer („Ingenieur*in“) wird trotz neutralem Genus eher männlich konnotiert, das Wort beautician („Kosmetiker*in“) eher weiblich.
Sprache ohne Geschlecht?
Könnte man Geschlecht nicht zumindest als sprachliche Kategorie einfach abschaffen, und wäre das eine Lösung auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit? Im Finnischen reicht ein Pronomen für alle: hän. Das Land ist auch in Bezug auf gesellschaftliche Gleichberechtigung sehr fortschrittlich. Inwieweit die Sprache hier einen Einfluss auf soziale Realitäten hat, ist jedoch nicht einfach nachzuvollziehen. Auch die Sprachen Persisch, Türkisch und Japanisch kommen ohne Genus aus. Makro-Studien haben versucht, Genus in der Sprache mit dem Stand der Gleichstellung zu korrelieren und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen 00 gekommen.
Deutsch ist jedenfalls nicht die einzige Sprache mit sprachlichen Neuerungen in Bezug auf Geschlecht. Die englische Sprache hat das Singular „they“ wiederentdeckt, Latinas und Latinos bezeichnen sich vermehrt als Latinx und erfinden neutrale Formen wie amigues („Freund*innen“). Es gibt in vielen Teilen der Welt den Bedarf, gesellschaftliche Veränderungen wie das Aufbrechen der sozialen Kategorie „Geschlecht“ in der Sprache sichtbar zu machen.
Wer Sprache und Gesellschaft untersucht, wer den Grenzbereich zwischen Natur und Kultur auslotet, hat mit Sachverhalten zu tun, die sich selten auf eindeutige Gesetzmäßigkeiten reduzieren lassen. Vielmehr führt die Forschung hinein in die Komplexität. Die Frage, was Geschlecht ist, wie sich Geschlecht in und mit Sprache konstituiert, ist durch die Forschung der letzten Jahre vielleicht schwieriger zu beantworten als je zuvor — und das ist eine gute Sache. Dennoch lassen sich einige Punkte festhalten:
1. Deutsch ist eine „Gendersprache“ – d.h. eine Sprache mit grammatischem Genus. Und diese Kategorie werden wir so schnell nicht wieder los.
2. Ob wir wollen oder nicht: Genus ist in unseren Gehirnen verankert und wir teilen die Welt in „der“, „die“ und „das“, Maskulinum, Femininum und Neutrum ein. Diese Einteilung prägt unser Denken.
3. Genus ist nicht gleich Sexus, aber sowohl in der Sprache als auch in unserer Wahrnehmung besteht ein bedeutender Zusammenhang.
4. Generische Lesarten von maskulinen Nomen sind möglich. Je nach Kontext sind sie manchmal naheliegend, manchmal nicht. Oft bleibt ein Interpretationsspielraum. Das Trügerische am generischen Maskulinums ist: Nicht alles, was generisch gemeint ist, wird auch generisch gelesen.
Die Diskussion darum, wie in der Sprache am besten mit Geschlecht umzugehen ist, lässt sich nicht trennen von den Veränderungen, die derzeit auf gesellschaftlicher und nicht zuletzt auch individuell menschlicher Ebene mit dem Verständnis von Geschlecht stattfinden. Das traditionelle Geschlechterverhältnis ist in vielen sozialen Milieus von einer durch nichts begrenzten Vielfalt abgelöst worden, in anderen sozialen Kreisen scheint es weiter zu beharren. Die Zukunft ist ungewiss, ein Trend zur Verflüssigung und eine Abkehr von der traditionellen Binarität lässt sich aber wohl generell feststellen und bekommt auch durch die Ergebnisse der Genderforschung eine wissenschaftliche Basis.
Die Sprache muss sich in irgendeiner Form zu diesen Veränderungen verhalten: Sie kann versuchen, sie abzubilden, wobei es nahe liegt, dafür auch neue sprachliche Mittel zu verwenden. Sie kann sogar versuchen, diese Prozesse mit anzuregen und zu formen. Bei allem Disput über die zugrundeliegenden Fragen darf man hoffen – und auch wünschen –, dass die Sprachpraxis nie zur Verwaltungsvorschrift erstarrt, sondern sich Bewegung, Freiheit und Spontaneität bewahrt.
Auch in unserem neuen Kanal zum Thema Mehrsprachigkeit geht es um eine gesellschaftsrelevante Dimension von Sprache – und wie sie sich verändert. Wie mehrsprachig lebt Deutschland – und wie lebt Deutschland mehrsprachig?